Essay von Markus Langemann //
Die Zeiten haben sich geändert, was die Art und Weise betrifft, wie wir im digitalen Zeitalter Kritik üben und annehmen. Wir erleben gerade einen signifikanten Wandel von einer Kultur der konstruktiven Kritik hin zu einer Situation, in der Ressentiments oft die Diskussion dominieren.
Das ist die Art von Entwicklung, die man in den sozialen Medien, in Blogs, in den Kommentarbereichen von Online-Plattformen und in der Phänomenologie der Shitstorms beobachten kann. Es handelt sich also wirklich um eine neue Form der Kommunikation, die sich von der traditionellen Kritik insofern unterscheidet, als sie sich auf eine Art und Weise moralisch überheblich gibt, die oft substanzlose Verachtung über konstruktive Argumente stellt.
Lassen Sie uns die Natur dieses Ressentiments untersuchen, seine Unterschiede zur traditionellen Kritik aufzeigen, seine Auswirkungen auf die Gesellschaft betrachten und schließlich überlegen, wie wir zu einem gesünderen Diskurs zurückkehren können.
Die Verschiebung hin zu Ressentiments in der digitalen Kommunikation wirft zentrale Fragen nach der Qualität und der Richtung unseres gesellschaftlichen Dialogs auf. Wenn wir diese Veränderungen verstehen, können wir besser darauf reagieren und auch eine Kultur des Respekts und des konstruktiven Austauschs wiederherstellen.
Die Natur des Ressentiments in der digitalen Kommunikation
Das digitale Zeitalter hat die Formen der Kommunikation, die Art und Weise der Meinungsäußerung und der Kritik verändert. Die Anonymität und die Reichweite des Internets bieten in der Tat ein fruchtbares Terrain für das Aufkommen von Ressentiments.
So sind Ressentiments durch grundlose Verachtung gekennzeichnet und werden oft ohne persönliche Konsequenzen geäußert, was manchmal der Argumentation oder der traditionellen, auf gegenseitigem Respekt beruhenden Kritik zuwiderläuft. Soziale Medien, Kommentarbereiche und Online-Foren ermöglichen eine rasche Verbreitung dieser anonymen Ressentiments und geben ihnen einen Vorhang, hinter dem sich ihre Beiträge verstecken können. All diese Faktoren tragen dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen sich frei fühlen, extremere, weniger durchdachte und oft verletzende Standpunkte vorzubringen und zu vertreten.
Die Tendenz dieser Plattformen besteht häufig darin, durch ihre Algorithmen nur Beiträge mit einer hohen Engagement-Rate (also die Gesamtzahl der Interaktionen, der Likes, der Kommentare, der Shares) zu fördern, unabhängig davon, ob sie von Qualität oder konstruktivem Wert sind. Übrig bleiben meist Echokammern, die in der Regel keine Herausforderung oder konstruktive Kritik zulassen, sondern eher das Bestehende noch verstärken.
Moralische Überlegenheit ist der Kern des digitalen Ressentiments. Die Nutzerinnen und Nutzer haben keine Skrupel, andere zu verurteilen, ohne dass es notwendig ist, deren Ansichten zu widersprechen oder in einen echten Dialog einzutreten.
Aus der “Froschperspektive” heraus führt diese “Vogelperspektive” zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung in der Argumentation. Hier geht es nicht mehr darum, aus der Kritik zu lernen oder sich durch sie zu verbessern, sondern es geht darum, den anderen zu deklassieren und sich selbst als moralisch überlegen darzustellen.
Die Verwandlung der Kritik
Von einem Instrument der Aufklärung und des Fortschritts hat sich die Kritik in ein Instrument, gar in eine Waffe, des Ressentiments und der Spaltung verwandelt.
Ein Wandel, der eng mit der Entwicklung der digitalen Kommunikation einhergeht.
War die Kritik früher eine Analyse der Argumente, auf die eine ausführliche Beurteilung folgte, so scheint sie heute oft ein Impuls ohne Bedeutungstiefe zu sein. Die digitalen Technologien, die so gut für Schnelligkeit und Effizienz sind, tragen eher dazu bei, kurze Urteile zu finden und zu verstärken, als eine detaillierte Analyse.
Dieser Akt der Verbreitung von Ressentiments anstelle einer kritisch verantwortlichen Beurteilung untergräbt den konstruktiven Dialog. Sie führen nicht zu einer Verständigung oder einer Lösung, sondern eher zu mehr Polarisierung und Entfremdung.
Diese Spaltungs-Dynamik wird also durch die digitale Kommunikation gefördert und vorangetrieben, die populäre Artikel durch Funktionen wie “Gefällt mir”, “Teilen” und “Kommentieren” im Gegensatz zu durchdachten Inhalten belohnt.
Auswirkungen auf die Gesellschaft
Die Verlagerung der digitalen Kommunikation von Kritik zu Ressentiments ist verheerend für die Gesellschaft.
Sie fördert eine Kultur der Polarisierung – Gruppen graben sich in ihre jeweiligen Lager ein und nehmen die Ansichten der anderen Seite nicht mehr als legitim hin, wir sehen das gerade am politischen Diskurs im Land.
Dadurch wird es schwierig, eine gemeinsame Basis für Diskussionen und die wirksame Bewältigung gesellschaftlicher Probleme zu finden.
Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist die Erosion des öffentlichen Diskurses. Die öffentliche Sphäre gleicht immer mehr einem Schlachtfeld, in dem es nicht mehr darum geht, Verständnis zu gewinnen, sondern seine Gegner zu schlagen.
Eine solche Atmosphäre untergräbt in der Tat das demokratische Prinzip des Diskurses als Mittel zur Erzielung von Konsens und Fortschritt. Nicht zu unterschätzen ist auch der Verlust der Fähigkeit, sich einzufühlen und einen konstruktiven Dialog zu führen. Durch die ständige Konfrontation mit radikalen Meinungen und die Abwertung von Gegenpositionen wird eine Verhärtung der Fronten in Gang gesetzt, die das Verständnis oder gar die Berücksichtigung der Position des anderen erschwert.
Dies führt dazu, dass der soziale Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis, das die Grundlage für das Funktionieren einer pluralistischen Gesellschaft ist, gebrochen werden.
Zusammengefasst
Tatsächlich ist die Umwandlung von Kritik in Ressentiments in der digitalen Kommunikation eine wichtige Herausforderung für unsere moderne Gesellschaft. Die wachsenden Ressentiments sind ein Problem für die Qualität des öffentlichen Diskurses, aber noch mehr für die Fähigkeit, als Gesellschaft zu kommunizieren und zusammenzuwachsen. Deshalb ist es so wichtig, Strategien zu entwickeln, die eine Rückkehr zu einem konstruktiven und empathischen Austausch fördern.
Dies könnte von der Förderung digitaler Medienkompetenz, die es den Nutzern ermöglicht, kritisch mit Informationen umzugehen und zu wissen, wie sie die Auswirkungen ihrer Online-Interaktionen bewältigen können, bis hin zu Leitprinzipien reichen, die bei der Gestaltung von Plattformen einen konstruktiven Beitrag leisten und toxische Verhaltensweisen minimieren.
Vor allem bedarf es eines gemeinsamen Umdenkens in der Art und Weise, wie wir kommunizieren und miteinander umgehen, um digitale Ressentiments zu überwinden.
Wie sehr die digitalen Ressentiments bereits Einzug in der analogen Welt gefunden haben, lässt sich täglich an der aggressiven, oft sinnentleerten, politischen Sprache, in diesem Land ablesen.
Es geht vielmehr um die Förderung einer Kultur des gegenseitigen Respekts und Verständnisses, die über die Grenzen digitaler Plattformen hinausgeht und die Grundlage unseres gesamten sozialen Miteinanders bildet.
Man kann nur hoffen, dass wir durch einen solchen Wandel in der Lage sein werden, die Schwierigkeiten dieses digitalen Zeitalters zu überwinden und eine Gesellschaft hervorzubringen, die von Respekt, Verständnis und letztlich von Fortschritt geprägt ist.
Einen bescheidenen Teil zu einem respektvollen Umgang mit der anderen Meinung, im Sinne einer gesunden Kritik, will der Club der klaren Worte beitragen. In den Kommentarbereichen der jeweiligen Artikel wird das von Ihnen gelebt.

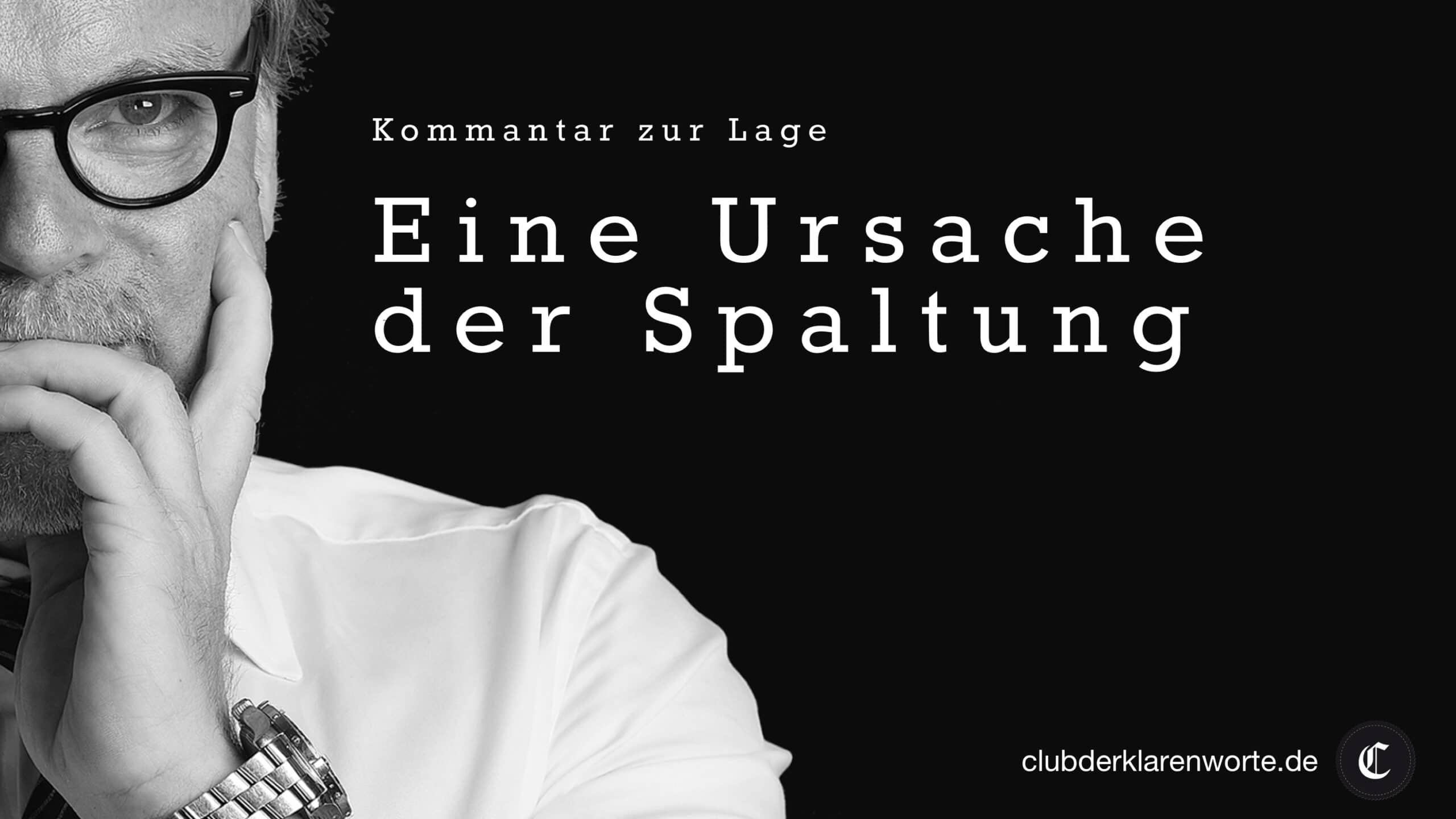
7 Responses
Machen wir uns trotz allen von uns erkannten Irrsinns für die Neugier, auf das, was der andere zu sagen hat, stark. Ohne Ansehen der Person. Könnte ein Krümelchen Wahrheit drin stecken?
Suchen wir wenigstens eine kleine Gemeinsamkeit (vielleicht wir ja sogar eine!) bevor wir die Differenzen betonen.
Lassen wir dem anderen die Möglichkeit, aus der Schublade, in die wir ihn verfrachtet haben, wieder rauszusteigen.
Kultivieren wir im Gespräch unseren Humor – einen Humor, der nicht verletzt, sondern öffnet.
Man lässt einander nicht mehr in Ruhe arbeiten, denken, lesen.
Ob das vordergründig ein Problem digitaler Kommunikation – für die ich keine Lanze brechen will – ist ?
Sieht man sich beispielsweise den Inhaber des höchsten Staatsamts an, dessen raison d’être eigentlich Ausgleich, Vermittlung, Zusammenhalt mehr als alles Andere zu sein hätte und vergleicht mit Amtsinhabern von Format (v. Weizsäcker, Heinemann) … Da kann einem schon der Gedanke kommen, daß die Polarisierung nicht unbedingt primär ein Phänomen von in digitalen Medien kultivierten Ressentiments ist.
Allein diese Überlegung gilt ja mittlerweile als Gedankenverbrechen und ist verfassungsschutzrechtlich relevante Staatsdelegitimierung – ein weiterer Indikator dafür, daß die führenden Probleme vielleicht woanders liegen.
Ich sehe das ganz genauso, zu mal bis in höchste Kreise die Manieren oder ganz einfache Ehrbegriffe vergessen zu sein scheinen. Es gab Bundespräsidenten, die dieser Anforderung genügen wollten und auch konnten. Gleiches gilt natürlich für Kulturschaffende, Volksvertreter, Intellektuelle, Medienschaffende und nicht zuletzt Wissenschaftler – besonders schwierig: Ärzte. In den früheren, meist ungebildeten und ländlichen Dorfgemeinschaften war es ganz ähnlich, was nicht paßte wurde passend gemacht oder ausgestoßen. Wir alle können sehen, dass die kulturelle Entwicklung in unserer Gesellschaft rückwärts, hin zum Primitiven geht. So sieht man, wie Wissenschaft zur Ideologie oder zum Kult verkommt. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, das wir alle – im übertragenen Sinn – wieder Unfreie in einer Feudalherrschaft werden sollen. Das Experiment des real existierenden Sozialismus, in dem die Nomenklatura die Rolle der Barone ausgefüllt hatte, war im gewissen Sinne eine Feudalgesellschaft ohne Adel. Manieren und Ehre, frei nach Asfa Wossen Asserate, sind ein gewisser Luxus, den man sich sich leisten sollte. Ich denke, etwas Besseres könnte uns gar nicht passieren. Funktionieren wird es allerdings nur, wenn jeder bei sich anfängt.
der Mensch ist….. wie er nun einmal ist. Der Durchschnitt benötigt täglich seine Sau die er durch‘s Dorf treiben kann.
Egal ob mit dem Nachbarn über den Zaun, in der Früchstückspause, auf dem Hof, am Fenster….. überall muss er wettern, hetzen und sich irgendwie über irgendetwas aufregen. Bisher musste er sich selber überlegen wen er zu seiner „Sau“ machen möchte. Selbst überlegen, als Vorraussetzung, hatte zur Folge das es weitestgehend einigermaßen gesittet dabei zuging.
Inzwischen ist „Sau“ selber suchen überflüssig. Jeder erhält seine „Sau“ täglich per ARD u. ZDF (gegen Gebühr versteht sich)
Coronaleugner, Ungeimpfte, Klimaleugner, Putinversteher, Putin, Trump, Orban, AFD, AFD Wähler etc.
Die Auswahl ist wunderbar üppig. So nimmt der Durchschnitt, frei nach dem Motto „All you can eat“ alles mit. Denken, hinterfragen, selber recherchieren, eigene Meinung gar nicht mehr notwendig denn alles wurde bereits hinreichend vorgekaut. Nur noch schlucken und ab….an den Zaun……..von Marietta Slomka pers. gecheckt…auf der richtigen Seite
In diesen Zeiten bietet die s.g. Politik und deren MSM mit den gegenwärtigen Protagonisten nicht nur jede Menge Stoff um die o.g Bedürfnisse zu befriedigen sie macht auch vor das man „Säuen“ einzig und allein mit Ressentiments begegnet.
Der Appell an mehr Kritikfähigkeit und Diskursbereitschaft ist absolut zu begrüßen und wünschenswert aber Dazu benötigt es erstmal ein Bildungssystem das seinen Namen Wert ist. Einen vollkommen ausgetauschten und abgespeckten ÖRR und natürlich kluge, gebildete und integere Politiker sowie Fachkräfte als Minister.
Fazit: Kritikfähigkeit und Diskursbereitschaft wurden (PISA lässt grüßen) durch Cancelculture ersetzt.
PS. Ausnahmen bestätigen die Regel
Besser kann man es nicht sagen, ganz meine Meinung. Aber… wie kommen wir aus dieser Misere wieder raus? Ich kann und will mir nicht vorstellen, was passieren könnte.
Ich teile die Einschätzung uneingeschränkt, möchte nur insoweit ergänzen, dass die gesellschaftliche Spaltung von Politik und deren medialer Verstärkung durchaus gewünscht ist. Dies war durchaus nicht immer (zumindest nicht in diesem Ausmaß) so und führt mich zu der Frage, ob dies eine ungeplante oder gesteuerte Entwicklung ist.